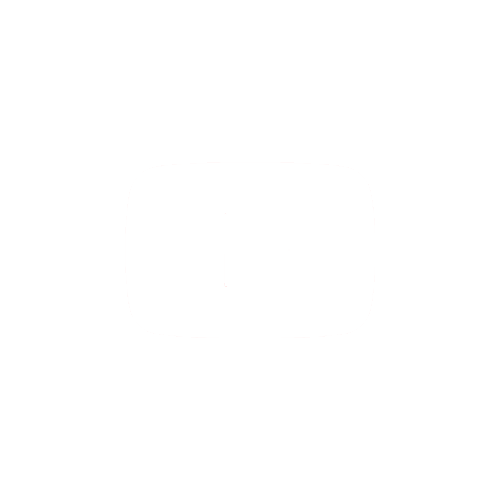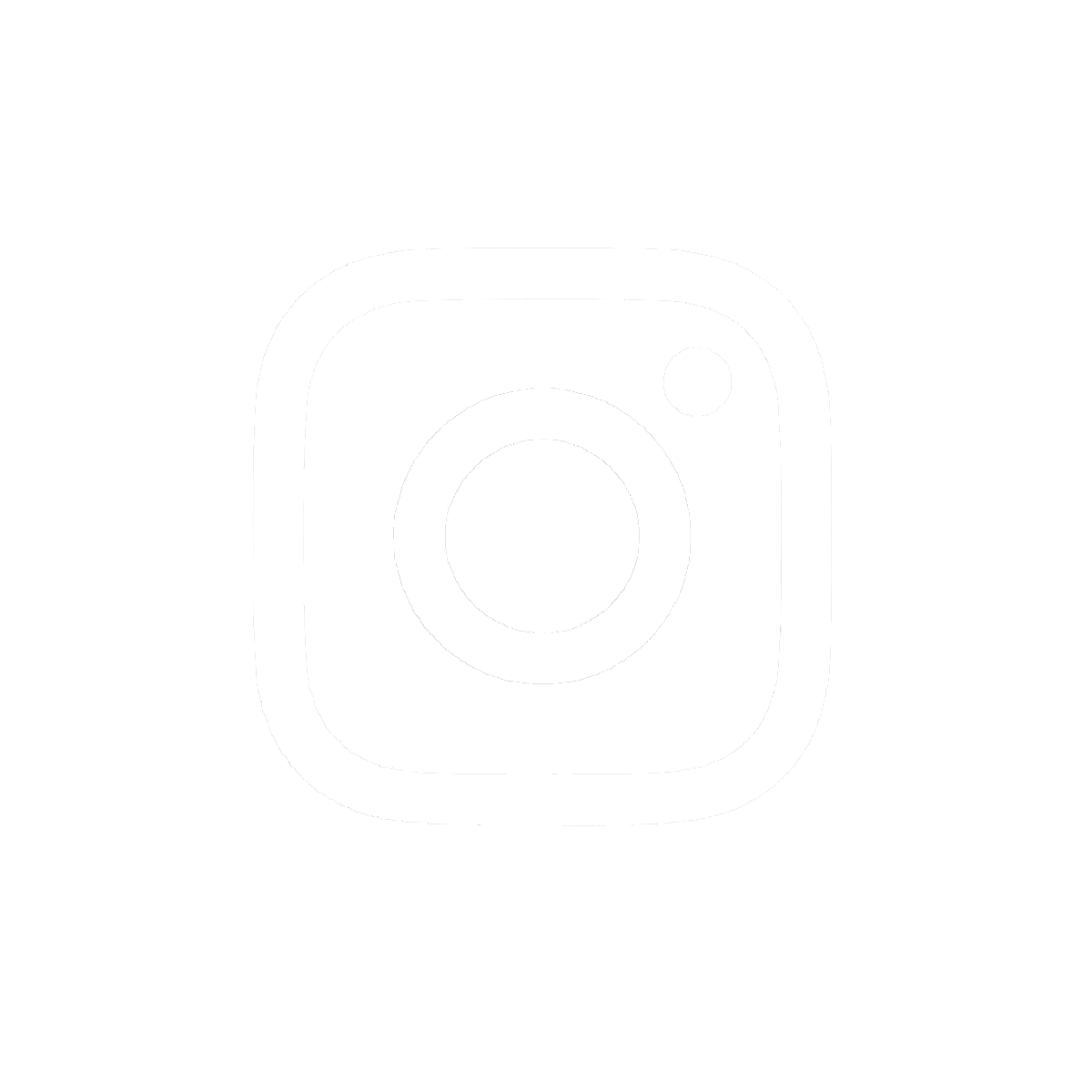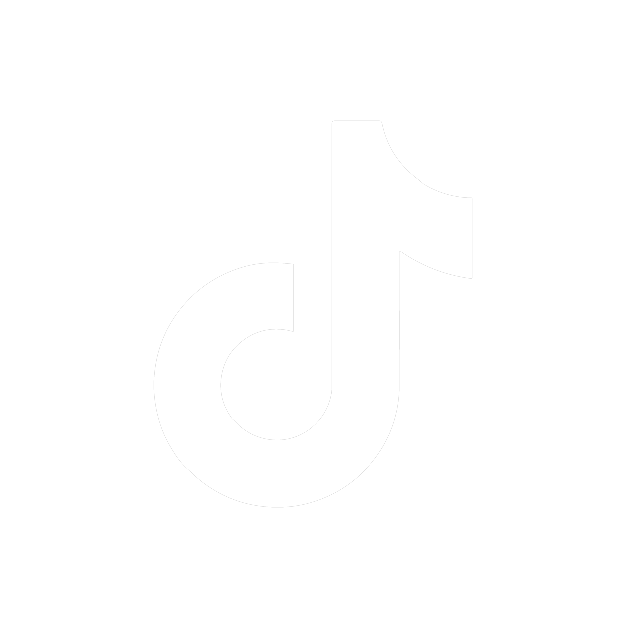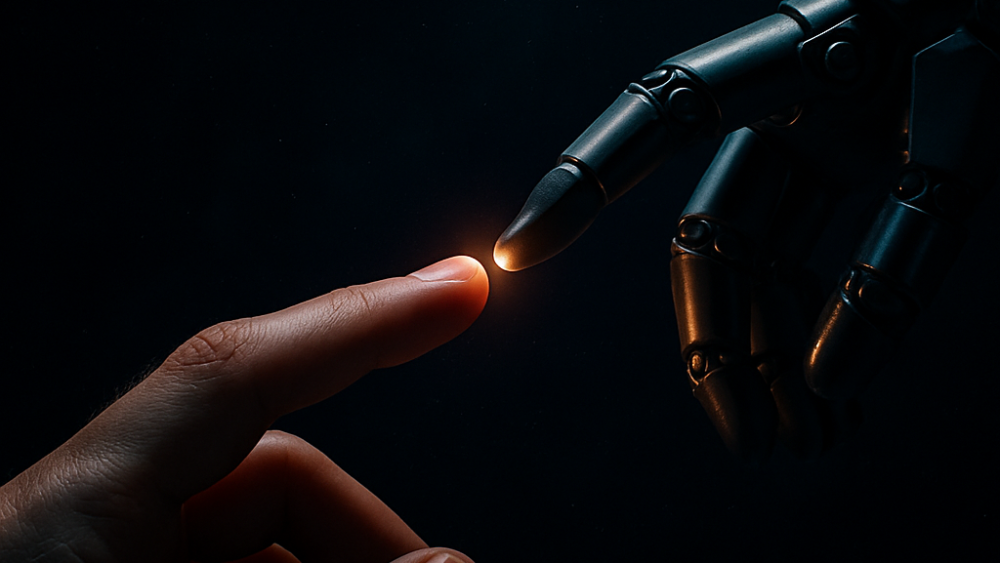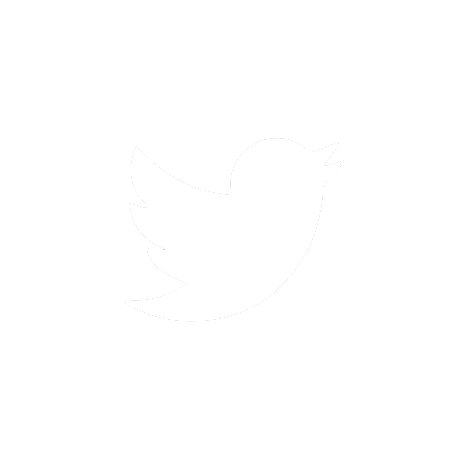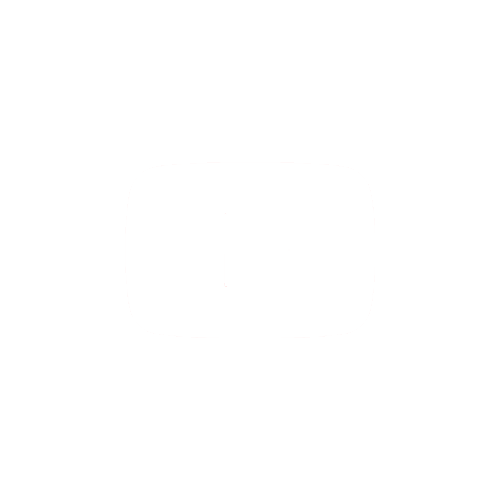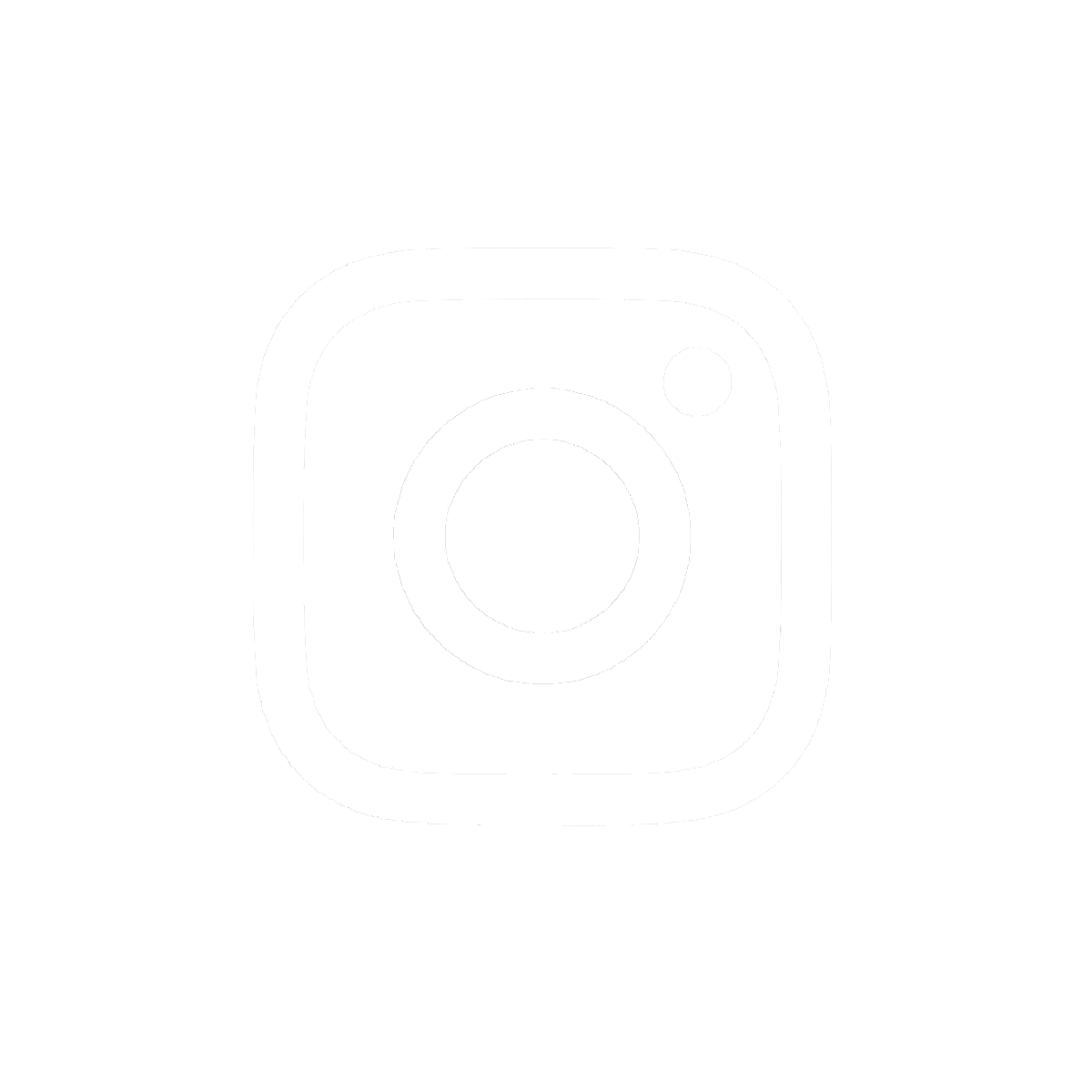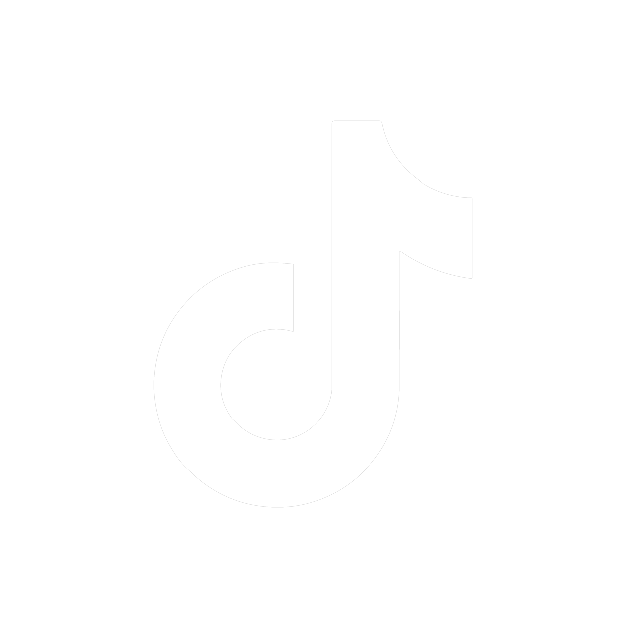Das deutsche Wort “Automat” leitet sich ab vom altgriechischen „automatos“, welches wahlweise eine sich selbst-bewegende, selbst-handelnde bzw. selbst-denkende Person oder Sache beschreibt. Im zeitgenössischen Sprachgebrauch verengt sich die Wortbedeutung etwas; gemeinhin versteht man darunter eine technische Apparatur, die nach einmaliger Aktivierung ohne menschliches Zutun vorprogrammierte Arbeitsabläufe und Dienstleistungen ausführt. Beispielsweise der Fehlfunktion-geplagte Pfandautomat im Supermarkt um die Ecke, an dem lediglich leisen Gerüchten zufolge jemals erfolgreich Leergut abgegeben wurde.
Aber auch Slotmaschinen in Casinos gehören dazu. Alles, was es braucht, ist ein Händedruck mit dem einarmigen Bandit und schon setzt ein Mechanismus in Gang, an dessen Ende einem zuverlässig mitgeteilt wird, ob man nun 100, 80 oder immerhin nur 50 Prozent seines Einsatzes verloren hat. Es sei denn, man ist – durch echtes Glück oder Foul Play – Teil eines kleinen Kreises von Privilegierten, die die Spielbank mit einem Nettogewinn verlassen. Oder sie gar nicht verlassen müssen, weil ihnen das Haus gehört, und das Haus gewinnt immer. Nein, es geht in diesem Text natürlich nicht um Glücksspiel, aber die Metapher passt zum eigentlichen Thema.
Automaten als Symbol kapitalistischer Kontrolle
Konkret: Die erwartbare, weitere Beschleunigung der Automatisierung von Produktionsprozessen und die damit einhergehenden Folgen für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Denn: Seit Anbruch der Industriellen Revolution hat das Produktivitätswachstum, bedingt durch technologische Innovationen und die Erschließung neuartiger Energiequellen (sowie die gewaltsame Ausbeutung vieler Länder des Globalen Südens durch die des Nordens, um das nicht unerwähnt zu lassen), mehrere Schübe erlebt. Von kohlegetriebener Dampfkraft über Elektrizität, Erdölraffinerien und Gaskraftwerke, bis hin zur weltweiten Vernetzung mittels moderner Kommunikations- und Informationstechnologien.
Praktisch jedesmal ging der Anstieg der wirtschaftlichen Produktivität einher mit einem Anstieg des wirtschaftlichen Outputs – da kosteneffizienter produziert werden konnte, wurde nach klassisch-kapitalistischer Logik auch mehr produziert. In der Folge wurden die volkswirtschaftlichen Kapazitäten (Zugriff auf Rohstoffe, Produktionsmittel und Arbeitskräfte) regelmäßig ausgereizt und ausgeweitet. Wenngleich diese Entwicklung im 19. Jahrhundert noch weit verbreitete Erscheinungsformen wie Pauperismus, (Lohn-)Sklaverei und Kolonialkriege annahm, so änderten sich mit Zunahme des relativen Wohlstands in den westlichen Industriegesellschaften die Wertschöpfungsmethoden dahingehend, sie – oberflächlich betrachtet – besser in Einklang mit den selbstgesetzten Idealen der Aufklärung zu bringen. Die grundlegende Dynamik blieb jedoch erhalten.
Nach außen basiert unser Wirtschaftsmodell bis heute auf neoimperialistischen Handelsstrukturen oder profitiert zumindest davon, während im Inneren der Konflikt zwischen Arbeit- und Kapitalseite von einem Klassenkompromiss übertüncht wird, der geflissentlich als “Sozialpartnerschaft” vermarktet wird, wobei der Nutzen dieser Partnerschaft in seiner Verteilung mit dem jeweiligen Anteil der beiden Partner am Volksvermögen zu korrelieren scheint. Wenn man bedenkt, dass dieser Kompromiss gleichwohl von Generationen von Werktätigen schwer erkämpft werden musste – und es gibt dafür freilich keinen besseren Anlass als den internationalen Kampftag der Arbeiter:innenklasse – und wie sie das erreicht haben, dann drängen sich mit Blick auf die Zukunft einige unschöne Schlussfolgerungen auf.
Produktivität, Klassenkompromiss und das Ende kollektiver Macht
In der (inzwischen institutionalisierten) Auseinandersetzung zwischen den abhängig Beschäftigten auf der einen, und den die Produktionsmittel Besitzenden auf der anderen Seite, war das einzig relevante Druckmittel, welches Ersteren zur Verfügung steht, seit jeher die Verweigerung ihrer Arbeit. Weil die kapitalistische Klasse, wie bereits dargelegt, im langfristigen Trend der Produktivitätssteigerung auf die Ausweitung ihrer Produktions- und Dienstleistungskapazitäten angewiesen war, um sich im kapitalistischen Wettbewerb gegen die Konkurrenz zu behaupten, konnte die Arbeiter:innenklasse stets darauf zählen, dass Streiks ihre Wirkung nicht verfehlten. Kapitalisten können ihre Maschinen schließlich nicht selbst bedienen; schon allein deshalb nicht, weil sie dazu zu wenige sind.
Das Ende des Kalten Krieges und die Etablierung des Internets in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts läuteten den vorerst letzten großen Produktivitätsschub ein. Mit dem Siegeszug der Globalisierung und ihren arbeitsteiligen Effekten, die eine Optimierung der Lieferketten in nie zuvor gesehenem Ausmaß ermöglichten, hat sich die globale, kaufkraftbereinigte Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung seit 1990 vervierfacht. Angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen spricht allerdings einiges dafür, dass dieser Brunnen ausgeschöpft ist. Am Horizont schwappt die nächste Welle in Gestalt KI-gestützter Automatisierung zu uns herüber. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie sich noch als Tsunami herausstellen wird.
Die schon jetzt mögliche und praktizierte volldigitale Automatisierung von bestimmten Produktions- und Dienstleistungsprozessen durch agentische Software, sowie absehbar auch die hybride Variante mit humanoiden Robotern, die sich in der physischen Welt bewegen, eigenständig handeln und selbst-”denken” können, unterscheiden sich insofern fundamental von vorhergehenden Etappen des Produktivitätswachstums, als dass sie (menschliche) Arbeit als Produktionsfaktor nahezu vollkommen obsolet machen. Anstatt mehr und neue Jobs zu schaffen, werden viele Arbeitsplätze dauerhaft vernichtet. Wenn das Kapital den Produktionsvorgang vollständig übernimmt, sich gar selbst ohne menschliches Zutun reproduziert, dann werden Arbeiter:innen mittelfristig aus den Werkshallen und Büros verschwinden, verdrängt von hyperproduktiven, superintelligenten Automaten.
Betreffen würde dies Beschäftigte in fast allen Sektoren; zuerst white-collar, dann blue-collar Jobs. Am längsten würden wahrscheinlich Tätigkeiten in sozialen Bereichen überleben, bei denen direkte Mensch-zu-Mensch-Interaktion unbedingt erforderlich oder erwünscht ist. Die Geschwindigkeit dieser wirtschaftlichen Transformation hängt davon ab, wie stark und schnell Faktoren wie Rohstoffextraktion (zum Bau von Computerchips und Robotern) und Rechenleistung (zum Training der KI-Programme) skaliert werden können, und inwieweit jene Programme in der Lage sein werden, sich iterativ selbst zu verbessern. Zahlreiche Projektionen sagen eine exponentielle Fortschrittsrate voraus, einige Szenarien betonen zudem existenzielle Risiken für die menschliche Zivilisation.
KI-Revolution und technofeudale Zukunft
Ob nur ein paar Jahre oder doch noch Jahrzehnte vergehen, bis die Welle über uns hereinbricht – Unabhängig vom Zeitrahmen des bevorstehenden Wandels sollten wir gesamtgesellschaftlich sehr bald beginnen darüber nachzudenken, wie wir reagieren wollen. Im Fall tatsächlich eintretender, massiver und sprunghaft steigender Erwerbslosigkeit, ist es weder sozial- noch konjunkturpolitisch vertretbar, die ausfallenden Erwerbseinkünfte durch Kurzarbeiter- oder Bürgergeld zu ersetzen und “Umschulungen” anzubieten. Im Zweifel wäre es aber genau das, was passieren würde, wenn die hiesige Arbeiter:innenklasse sich samt ihres klassenkämpferischen Aktionspotentials in Luft auflöst.
Hinzu kommt die politökonomische Komponente. In einer Welt überbordender KI-geboosteter Kapitalrenditen bei gleichzeitiger Entlassung eines Großteils der Bevölkerung aus ihren Beschäftigungsverhältnissen ist die Explosion der statistischen Einkommens- und Vermögensungleichheit vorgezeichnet. Niemand mit Verstand mag behaupten, dass die aktuellen Verhältnisse den Ansprüchen an eine gerechte Gesellschaft im Entferntesten genügen. Schlimmer geht es dennoch immer. Das bereits bestehende Sozialgefälle würde vom Hang zur gebirgshohen Klippe und womöglich auf ewig in Stein gemeißelt. Wer wenig hat, hätte noch weniger. Wer viel hat, hätte noch sehr viel mehr. Oligarchie, ick hör dir trapsen.
Es ist wie mit dem Glücksspiel im Casino. Alles, was es braucht, ist eine Leistungsgegenüberstellung mit dem einarmigen Bandit und schon setzt ein Mechanismus in Gang, an dessen Ende einem zuverlässig mitgeteilt wird, ob man nun 100, 80 oder immerhin nur 50 Prozent seiner bezahlten Arbeitszeit gestrichen bekommt, weil der Apparillo die Arbeit einfach besser macht – kein Vergleich zum Pfandautomaten Jahre zuvor. Es sei denn, man ist – etwa durch Erbschaft oder Unternehmertum – Teil eines kleinen Kreises von Privilegierten, die von Anfang an die richtigen Karten (bzw. Aktien) halten. Dass die technofeudalen Lehnsherren der Gegenwart dazu gehören, ist klar, doch im Raumschiff Richtung Mars sind für findige Opportunisten garantiert noch Plätze frei. Bitte einsteigen!
Zum Tag der Arbeit 2025: Fünf Forderungen aus dem Grundsatzprogramm von MERA25
- Zeit für das universelle Lebenseinkommen!
Wir fordern die schrittweise Einführung eines universellen Lebenseinkommens, das genug finanzielle Sicherheit bietet, um in Würde und bescheidenem Wohlstand am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, und universell allen Mitgliedern der Gesellschaft gleichermaßen offensteht. Die Implementierung kann zunächst über das Instrument einer bedingungslosen Grunddividende erfolgen, welches insbesondere die Gewinnausschüttungen großer Tech-Konzerne abschöpft und an die Bevölkerung zurückfließen lässt.
- Her mit der Vier-Tage-Woche!
Eine Reduktion der Regelarbeitszeit ist angesichts anhaltender Produktivitätszuwächse lange überfällig. Wir wollen die Vier-Tage- bzw. 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich zum Gesetz machen und Betriebe anfänglich durch Subventionen bei der Umsetzung unterstützen. Eine Aufweichung der Arbeitszeitregelungen à la Merz & Co. darf und wird es mit uns niemals geben!
- Staatliche Jobgarantie ahoi!
Das Konzept der Jobgarantie im öffentlichen Sektor wurde bereits mehrfach erfolgreich erprobt. Wir sprechen uns klar für die Garantie niedrigschwelliger und sinnstiftender Beschäftigungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene aus, um vorhandene Bedarfe zu decken und erwerbslos gewordene Menschen aufzufangen. Die so entstehenden Jobs konkurrieren nicht mit dem Privatsektor, sondern dienen als antizyklischer Stabilisator in Zeiten konjunkturellen Abschwungs, wodurch sie ebenso makroökonomischen Nutzen bringen.
- Betriebe in die Hand derjenigen, die dort arbeiten!
Demokratie bedeutet für uns mehr, als bloß alle paar Jahren bei Parlamentswahlen ein Kreuz zu setzen. Werte wie Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit lassen sich nur verwirklichen, wenn auch die Wirtschaft nach Maßstäben von Transparenz und Mitbestimmung funktioniert – ein Mensch, ein Anteil, eine Stimme. Kooperative und genossenschaftliche Unternehmensformen möchten wir konsequent fördern und langfristig zum verbindlichen Standard machen.
- Digitalisierung made in Europe!
Wir beabsichtigen, massive Investitionen in den Aufbau einer staatseigenen europäischen Mikrochip-Produktion zu stecken, um die kontinentale Nachfrage nach integrierten Schaltkreisen zu decken, moderne Industriearbeitsplätze zu schaffen und internationale Abhängigkeiten abzubauen. Das demokratisch verwaltete Unternehmen soll dazu beitragen, Europas Handlungsfähigkeit und Unabhängigkeit angesichts eines drohenden digitalen Rüstungswettlaufs und handelspolitischer Disruptionen zu wahren.
Möchtest du über die Aktionen von DiEM25 informiert werden? Registriere dich hier