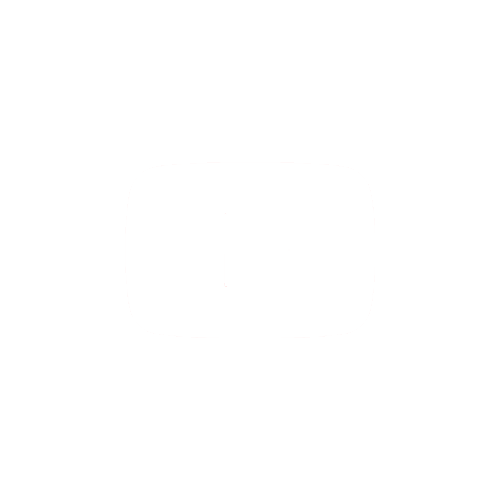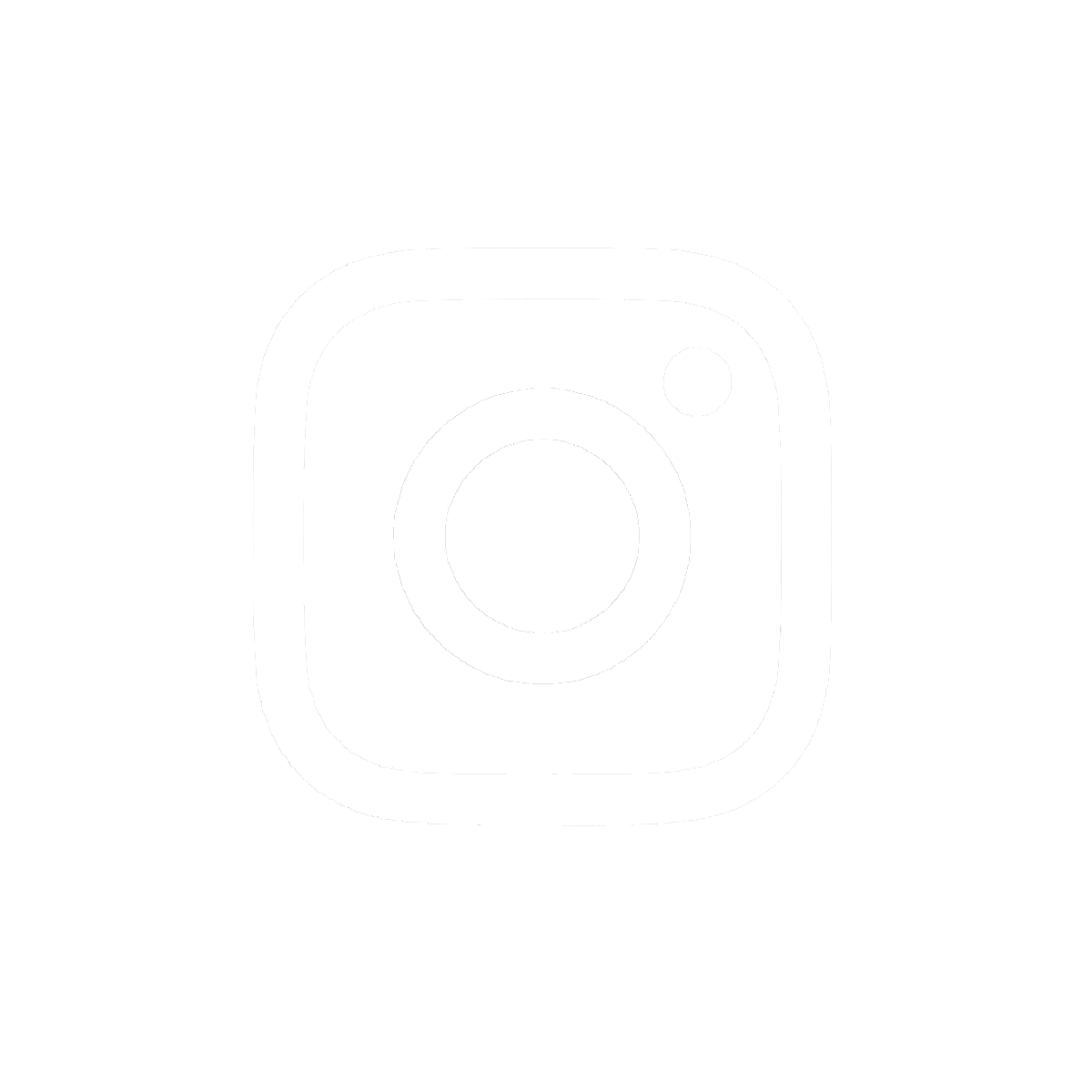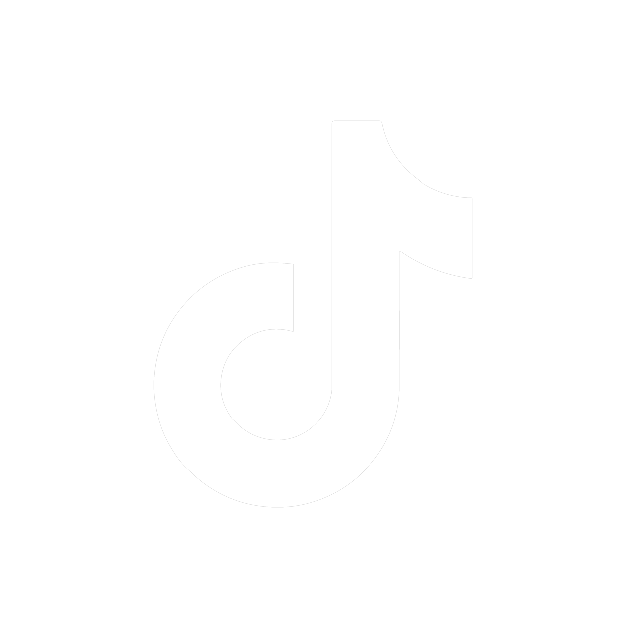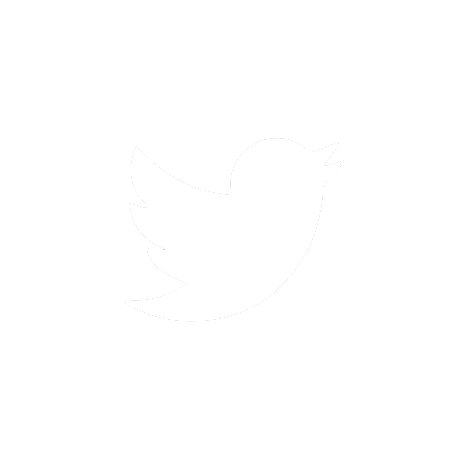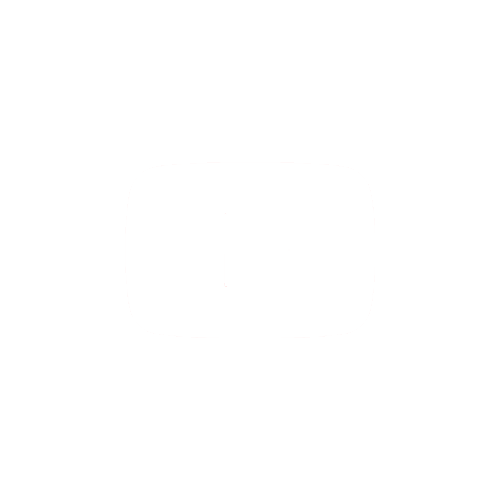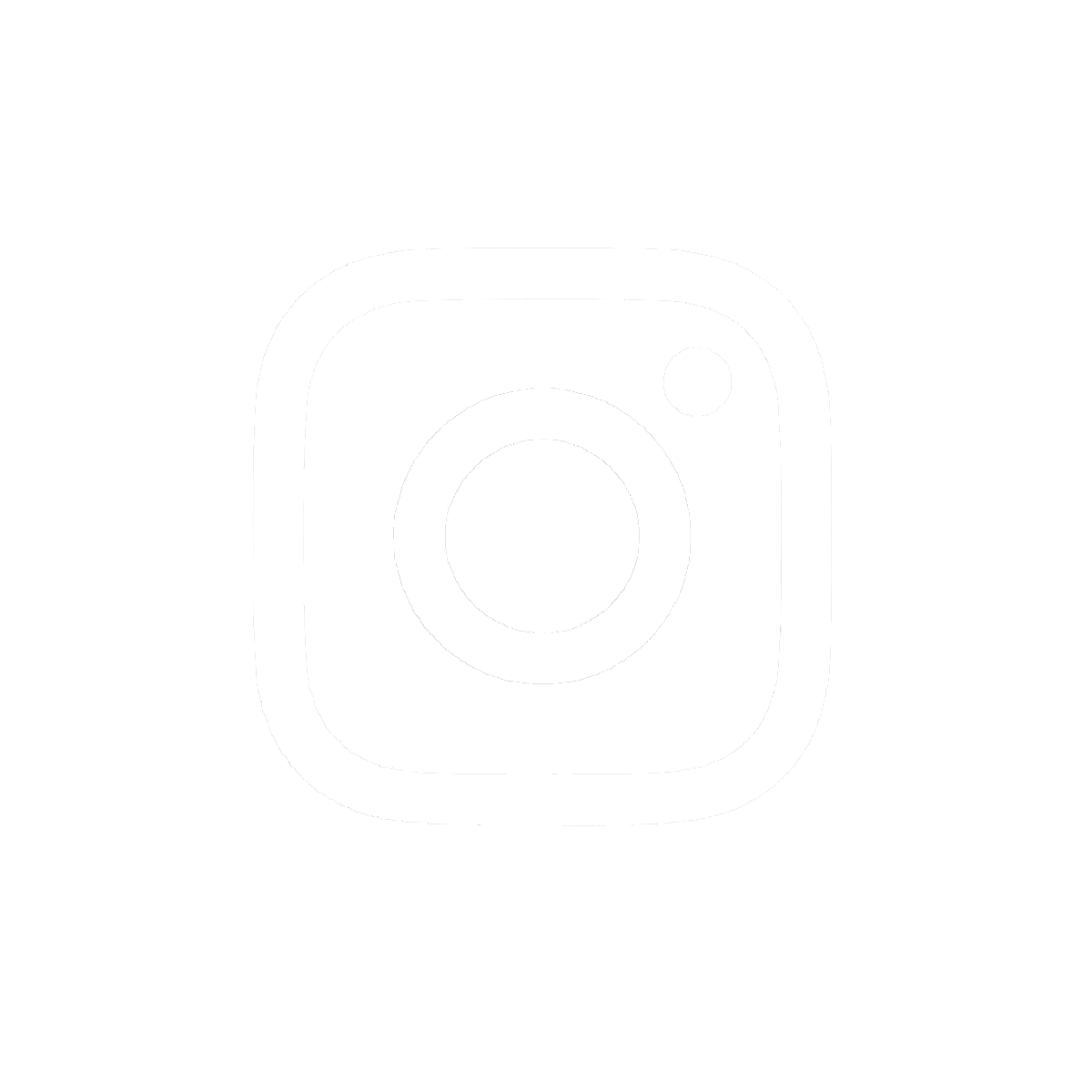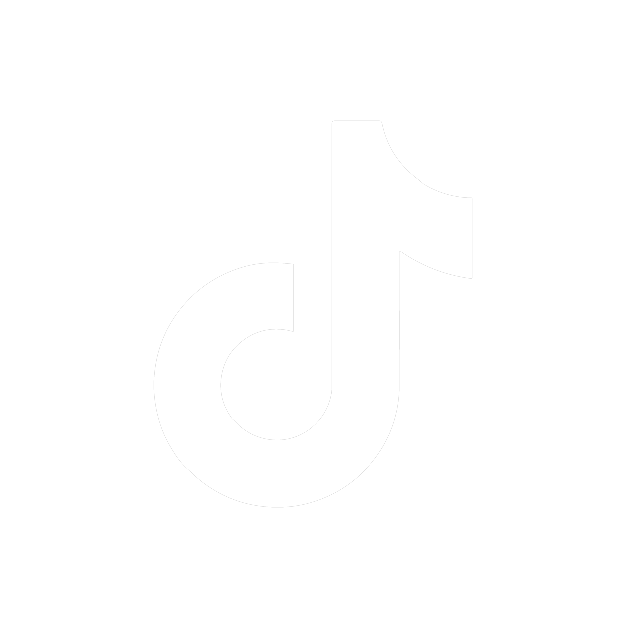«Einem Enkel einer Holocaust-Überlebenden das Wort zu versagen, das ist wirklich das Schlimmste, was ich in 25 Jahren Gedenkstättenarbeit erlebt habe.»
– Jens-Christian Wagner, Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, über die Ausladung des israelisch-deutschen Philosophen Omri Boehm auf politischen Druck der israelischen Regierung
„¡No Pasarán!“ – Sie werden nicht durchkommen:
Spanien. Im Juli 1936 putschte sich das Militär unter Franco gegen die gewählte Regierung in Spanien an die Macht. Die demokratische Volksfront leistete Widerstand – unter ihnen auch die kommunistische Politikerin Dolores Ibárruri. Sie rief damals: „¡No Pasarán!“ – „Sie werden nicht durchkommen!“ Dieser Satz wurde zum berühmten Ruf des Widerstands gegen Faschismus. Bis heute ist er ein Symbol für den Kampf gegen Unterdrückung – weit über Spanien und die damalige Zeit hinaus.
Deutschland. Am 11. April wurde der 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald gefeiert. Am 6. April 2025 hatte ich die Möglichkeit, an der Gedenkfeier in Buchenwald teilzunehmen. Für mich war es der erste Besuch in einer ehemaligen KZ-Gedenkstätte – ein zutiefst bewegender Moment voller Trauer, aber auch Hoffnung auf die Menschlichkeit und den antifaschistischen Mut, den die Überlebenden uns hinterlassen haben.
Doch meine erste persönliche Begegnung mit der NS-Vergangenheit wurde überschattet von etwas, das mich tief irritiert und bedrückt hat: Der israelisch-deutsche Philosoph Omri Boehm, dessen Familie selbst vom Holocaust betroffen war, wurde nach einer Einladung zur Gedenkfeier am 11. April in der Weimarhalle wieder ausgeladen – offenbar auf politischen Druck der israelischen Regierung. So, wie es der Gedenkstättenleiter Prof. Jens-Christian Wagner in einer Stellungnahme gegenüber der SRF formulierte, kann man die Ausladung als einen löblichen Akt bezeichnen, in der Boehm vor diesem Konflikt verschont werden soll. Man muss auch wissen, dass es zuvor Droh-Anrufe bei Überlebenden gegeben hatte, in der sie vor einem Loyalitätskonflikt gestellt worden waren.
Zum einen, loyal zu ihrer Regierung zu sein und auf der anderen Seite, die Loyalität zur Gedenkstätte zu wahren. Hier kann man zunächst davon ausgehen, dass es zum Schutz der Nachfahren der Holocaust-Überlebenden ging, denn sie sollten für die Regierung Israels instrumentalisiert werden. Wagner findet in einem rbb Interview vorerst die richtigen Worte: «Einem Enkel einer Holocaust-Überlebenden das Wort zu versagen, das ist wirklich das Schlimmste, was ich in 25 Jahren Gedenkstättenarbeit erlebt habe», Gegenüber SRF betont er: «Wir erleben weltweit, dass die liberalen Demokratien von rechtsautoritären Regierungen in die Zange genommen werden. Diese Regierungen betreiben knallharte Geschichtspolitik.» Die Einflussnahme der israelischen Regierung über die Botschaft in Berlin sehe Wagner in diesem Kontext.
So weit so gut. Worte, die angesichts der bedingungslosen Unterstützung Deutschlands für den israelischen Staat, gesagt werden müssen und wichtig sind, damit die Erinnerungskultur hierzulande nicht instrumentalisiert werden zum Machterhalt und der Ausweitung territorialer Gebiete.
Mal davon abgesehen, dass es bereits geschieht, weshalb die folgenden Erläuterungen nicht einleuchtend sind und eine logische Konsequenz hieraus ausbleibt:
Kurz darauf wurde während der Gedenkveranstaltung in Buchenwald eine junge Sprecherin zurechtgewiesen. Sie hatte bezüglich des im Jahr 1936 begonnenen Bürgerkriegs in Spanien und des erfolgreichen Umsturzes des gewählten Regierungs-Chefs mit Hilfe von Nazi-Deutschland und des faschistischen Italiens, die Möglichkeit gehabt, eine Rede zu halten. Denn nach dem Sieg Francos und der Errichtung einer faschistischen Diktatur wurden viele Menschen, die auf der Seite der Republik gekämpft hatten oder vor dem Krieg geflüchtet waren, später von den Nazis nach Buchenwald gebracht.
Weil sie in ihrer Rede auf das aktuelle Leid in Gaza und auf den Genozid hingewiesen hatte, fühlte sich der Gedenkstättenleiter Prof. Wagner wohl verpflichtet an das Podest heranzutreten und zu erklären, dass man hier nicht von einem Genozid sprechen könne und dass das Thema nicht hier her gehöre. „Sie hat auf Englisch gerufen „Wir kämpfen gegen den Genozid in Palästina“, gefolgt von dem Ruf „„¡No pasarán“, sagte Wagner in einem weiteren Interview. So lautete bekanntlich der Schlachtruf antifaschistischer Widerstandskämpfer im spanischen Bürgerkrieg. Übersetzt heißt das: „Sie kommen nicht vorbei!“ Wagner dazu: „Das war – an diesem Ort und an diesem Tag – ein antisemitischer Übergriff“.
Und hier kommt der Einsatz der „Deutschungshoheit“, den Prof. Wagner, während er ein Genozid leugnet, an den Tag legt: „(Der Ruf „¡No pasarán“) das kann ja nur als „Die Juden kommen nicht vorbei“ gedeutet werden. Ich bin spontan ans Mikrofon gegangen und habe mich sehr deutlich im Namen der Gedenkstätte distanziert.“
Diese Reaktion auf eine solidarische Stimme innerhalb einer Gedenkveranstaltung, die dem antifaschistischen Widerstand gewidmet war, ist meines Erachtens mehr als unangemessen und verstörend.
Trotz der Bemühungen Wagners sich schützend vor die Nachfahren der Holocaust-Überlebenden zu stellen, schafft Wagner es trotzdem nicht, die Situation angemessen zu bewältigen und bietet – ganz im Sinne der israelischen Regierung – der Instrumentalisierung eine Bühne. Es sollte hier nicht gefragt werden, was antisemitisch ist, sondern angesichts dieses Eklats eher gefragt werden: Wer bestimmt was antisemitisch ist?
Und was bedeutet „Nie wieder“ heute – und für wen?
Wird die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus instrumentalisiert, um aktuelles Unrecht zu verschweigen? Wer entscheidet, wann es legitim ist, über Völkermord zu sprechen – und wann nicht?
Gedenkkultur darf nicht selektiv sein. Die Erinnerung an die Opfer des Holocaust muss uns dazu verpflichten, jede Form von Unrecht und Entrechtung auch in der Gegenwart zu benennen – unabhängig von politischen Interessen.
Nur so bleiben wir glaubwürdig.
Ich finde es beängstigend, dass ausgerechnet in Deutschland jüdische Stimmen, die sich für Menschenrechte einsetzen, zensiert werden. Dass die Unterscheidung zwischen den „guten“ und den „unerwünschten“ Jüd:innen wieder gesellschaftsfähig wird. Dass der antifaschistische Schwur von Buchenwald – „Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus“ – auf vergangene Opfer reduziert wird, ohne die Gegenwart in den Blick zu nehmen. Wo ist hierbei der Lerneffekt, wenn wir es nur auf die Vergangenheit anwenden?
Gerade in Zeiten, in denen in Gaza tausende Zivilist:innen sterben, in denen das Völkerrecht massiv verletzt wird, brauchen wir Räume, in denen wir aus der Geschichte lernen – und nicht vergessen, dass Erinnerung politisch ist.
Ich wünsche mir eine Gedenkkultur, die mutig ist. Die unbequem sein darf. Die nicht schweigt, wenn erneut Unrecht geschieht. Denn der Satz „Nie wieder“ darf kein Mantra der Vergangenheit sein – er muss eine Lehre sein, die auf die Gegenwart und die Zukunft anzuwenden ist.
Meryem Yildiz
Mitglied bei MERA25 Hessen
Möchtest du über die Aktionen von DiEM25 informiert werden? Registriere dich hier