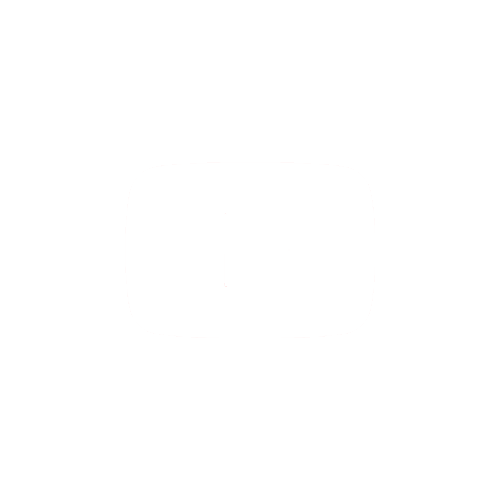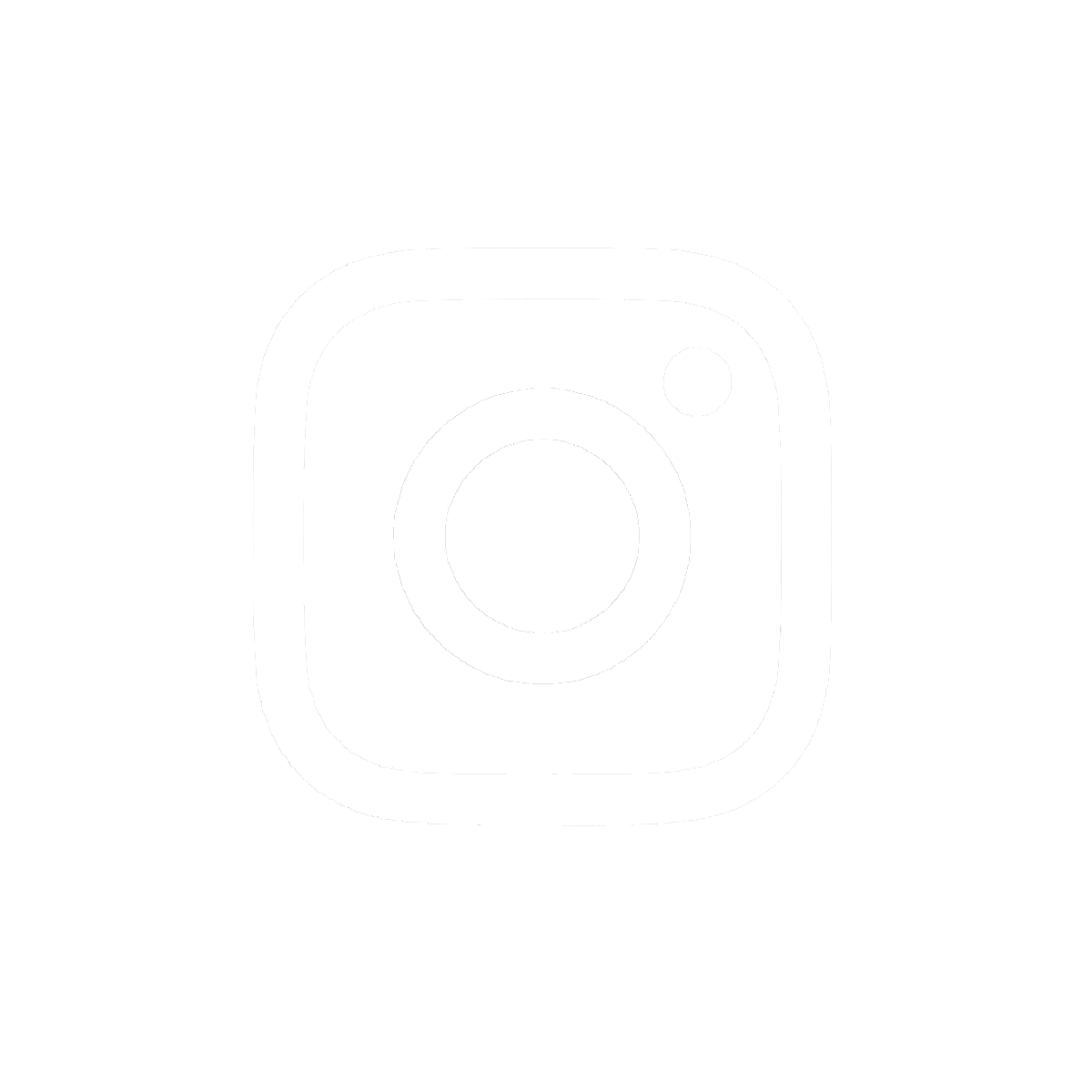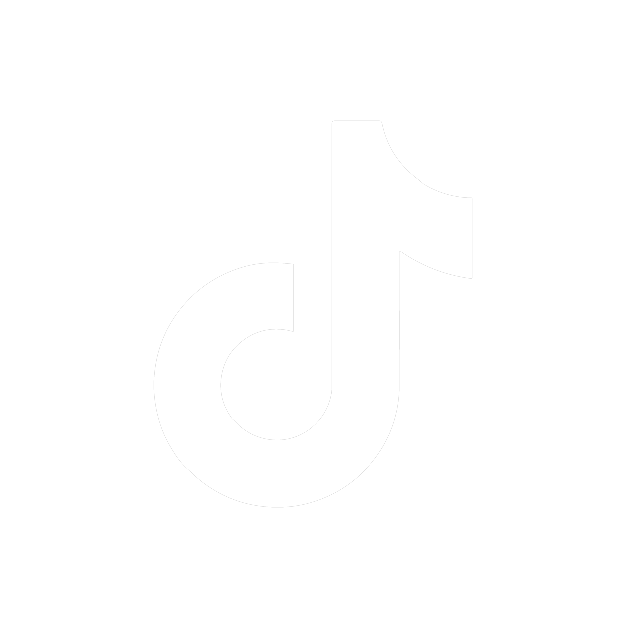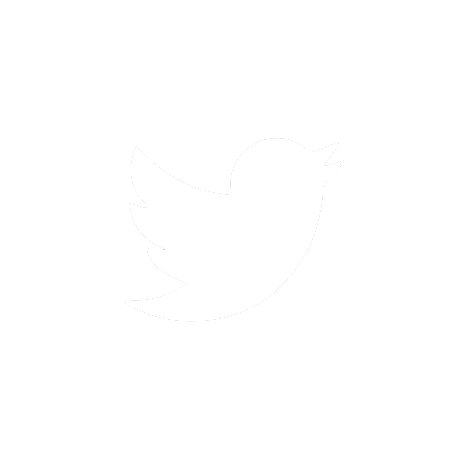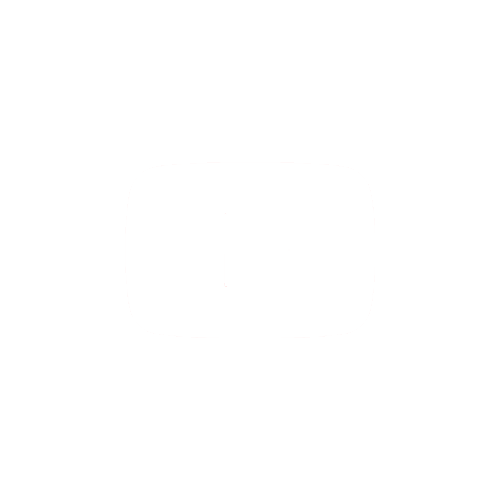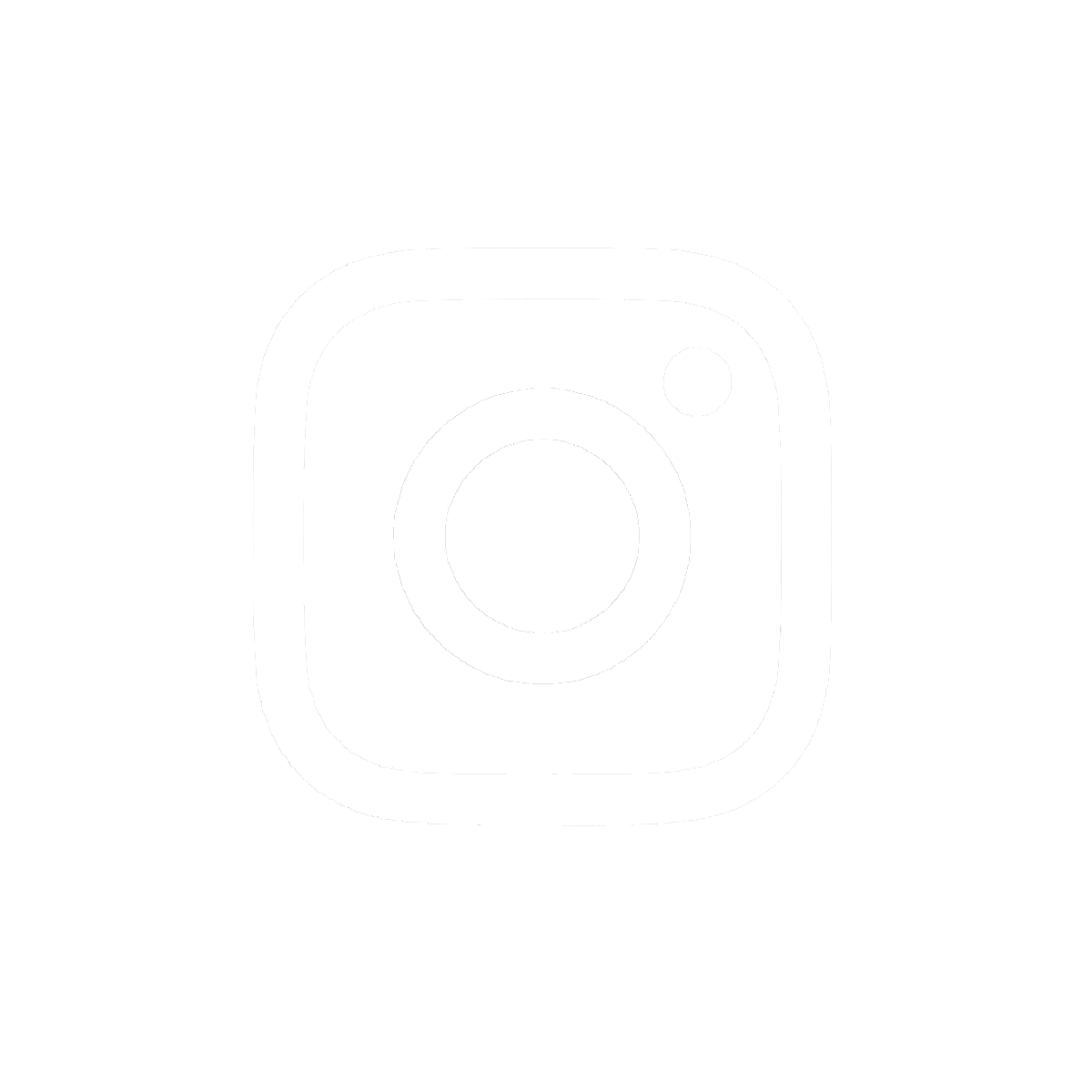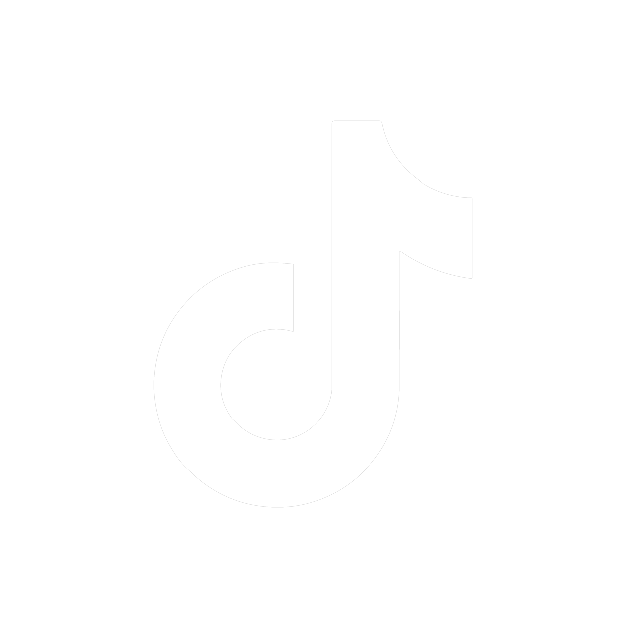Dies ist Teil Eins einer dreiteiligen Reihe zum Black History Month. Teil Zwei wird sich mit radikal linken Theorien des Schwarzen Widerstands befassen, und Teil Drei wird die anhaltenden Krisen beleuchten, mit denen Schwarze Gemeinschaften heute konfrontiert sind
Der Black History Month wurde 1926 vom Historiker Carter G. Woodson als einwöchiges Gedenken ins Leben gerufen, um an die Geschichte der Schwarzen Bevölkerung zu erinnern und die Öffentlichkeit zu bilden. Diese Initiative entstand in einer Zeit, in der der Ku-Klux-Klan erheblichen politischen und sozialen Einfluss ausübte und segregationistische Gesetze im US-amerikanischen Rechtssystem verankert waren. Unter dem repressiven Regime der Jim-Crow-Gesetze migrierten viele Schwarze Amerikaner:innen in den Norden, um wirtschaftliche und soziale Chancen zu suchen, wobei Städte wie Chicago, Philadelphia, Washington, D.C. und New York zu zentralen Zentren des Schwarzen Lebens wurden. Unter diesen Migrant:innen befand sich auch Carter G. Woodson, der 1903 von West Virginia nach Chicago zog und circa zehn Jahre später als erster Schwarzer Amerikaner einen Doktortitel in Geschichte erwarb.
In Anerkennung der systematischen Auslöschung Schwarzer Beiträge aus der nationalen Geschichte gründete Woodson die ‘Association for the Study of Negro Life and History’. 1926 führte er die ‘Negro History Week’ ein und wählte bewusst die zweite Februarwoche, um sie mit den Geburtstagen von Frederick Douglass und Abraham Lincoln zusammenfallen zu lassen. Die Woche war dem Hervorheben des Schwarzen Widerstands, der Feier der Schwarzen Kultur und der Notwendigkeit des historischen Bewusstseins gewidmet. „Wenn eine Rasse keine Geschichte hat…“, argumentierte Woodson, „wenn sie keine wertvollen Traditionen hat, …dann läuft sie Gefahr, ausgelöscht zu werden.“ Anders ausgedrückt spielt das historische Bewusstsein eine zentrale Rolle für die Selbstbestimmung einer Gemeinschaft und ihren Widerstand gegen systematische Unterdrückung. Im Laufe der Jahrzehnte entwickelte sich diese Initiative zu einer landesweiten Bildungsbewegung und wurde 1976 offiziell als Black History Month anerkannt.
Mit der Globalisierung des US-amerikanischen kulturellen und politischen Diskurses und dem wachsenden transnationalen Bewusstsein für rassistische Ungleichheiten hat der Black History Month auch in mehreren europäischen Ländern Anerkennung gefunden. Dennoch wird Schwarze Identität häufig durch eine liberale Linse betrachtet, die nicht nur westliche, sondern auch kapitalistische Narrative in den Mittelpunkt rückt. Zudem wird die Radikalität des Schwarzen Widerstands oft so weit heruntergespielt, dass er so nur eine konformere Version historischer Kämpfe darstellt. Angesichts des bevorstehenden 100-jährigen Jubiläums des Black History Month ist es notwendig, etablierte Narrative kritisch zu hinterfragen. Im Geiste von Carter G. Woodson untersucht diese Reihe drei oft vernachlässigte Perspektiven, mit dem Ziel, Widerstand zu inspirieren und Solidarität zu stärken.
Teil Eins: Afrodeutsche Geschichte
Der dominante Diskurs über Schwarze Geschichte und den Schwarzen Widerstand in Deutschland wird stark von US-amerikanischen Perspektiven geprägt. Dies führt oft zu dem Irrglauben, dass Deutschland keine koloniale Vergangenheit hat. Doch nur wenige Deutsche erkennen an, dass der sogenannte „Scramble for Africa“ – die gewaltsame Aufteilung des afrikanischen Kontinents durch europäische Mächte – 1884 in Berlin organisiert wurde, unter der Leitung von Otto von Bismarck, dem ersten deutschen Kanzler. Zwar begann die koloniale Ausbeutung nicht mit dieser Konferenz, doch sie kodifizierte die europäische Dominanz über afrikanische Gebiete und verankerte koloniale Gewalt auf eine Weise, die bis heute spürbar ist.
Deutschland nahm aktiv an dieser imperialistischen Aufteilung teil und beanspruchte Togo, Kamerun, Tansania (damals Deutsch-Ostafrika, einschließlich Teilen des heutigen Burundi und Ruanda) und Namibia (damals Deutsch-Südwestafrika). Obwohl die deutsche Kolonialherrschaft relativ kurz war – da Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg alle Kolonien verlor – war sie von außergewöhnlicher Brutalität geprägt. Zwischen 1904 und 1908 verübten deutsche Truppen einen Völkermord an den Herero und Nama, bei dem etwa 80 % der Herero-Bevölkerung und 50 % der Nama-Bevölkerung ermordet wurden. Fast 100.000 Menschen wurden ermordet. Dieses Verbrechen, das als erster Völkermord des 20. Jahrhunderts gilt, bleibt weitgehend aus dem kollektiven Gedächtnis Deutschlands ausgeschlossen. Bis heute fordern die Nachfahren der Opfer eine angemessene Anerkennung, Entschädigungen und Wiedergutmachung.
Während des NS-Regimes waren Schwarze Menschen in Deutschland systematischer Verfolgung und Gewalt ausgesetzt. Auch wenn der Nationalsozialismus keine systematische Vernichtungspolitik gegen Schwarze Gemeinden umfasste, führten Rassengesetze zu Zwangssterilisationen, Inhaftierungen und staatlich sanktionierter Gewalt. 1937 wurden Hunderte Schwarzer Kinder aus Westdeutschland zwangssterilisiert, um das Wachstum „gemischtrassiger“ Gemeinschaften zu verhindern. Beziehungen zwischen Schwarzen und weißen Menschen wurden kriminalisiert. Viele Afrodeutsche wurden in psychiatrische Kliniken eingewiesen, inhaftiert oder in Konzentrationslager deportiert. Mahjub bin Adam Mohamed beispielsweise wurde 1940 ins Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht, weil er gegen die NS-Rassengesetze verstoßen hatte, indem er eine Beziehung mit einer weißen Frau führte; dort starb er. Ebenso wurde Ferdinand James Allen, ein karibischer Musiker aus Großbritannien, 1933 zwangssterilisiert und 1941 im Rahmen des NS-Euthanasieprogramms in einer psychiatrischen Einrichtung ermordet. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Schwarze Bevölkerung Deutschlands stark dezimiert, marginalisiert und traumatisiert. Trotz der Verlegung von 75.000 Stolpersteinen (Gedenksteinen) für NS-Opfer, erinnern nur vier an Schwarze Opfer. Zeitgenössische Historiker:innen arbeiten noch immer daran, das gesamte Ausmaß der NS-Verbrechen gegen Schwarze Menschen aufzudecken.
Nach dem Krieg führte die US-Besatzung in Westdeutschland zu Beziehungen zwischen Schwarzen Soldaten und deutschen Frauen, die in Teilen der USA noch illegal waren und in Deutschland noch auf gesellschaftliche Ablehnung stießen. Die aus diesen Verbindungen geborenen afrodeutschen Kinder erlebten eine komplexe Bandbreite an Diskriminierung – von sozialer Ausgrenzung und rassistischen Stereotypen bis hin zu Fetischisierung und Exotisierung. Viele verloren den Kontakt zu ihren Vätern nach deren Versetzung, während andere von ihren deutschen Müttern getrennt und in die USA gebracht wurden. Noch heute suchen viele dieser Kinder nach ihren biologischen Familien.
Doch Afrodeutsche sollten nicht allein als Opfer in der Geschichte wahrgenommen werden. Schwarze Gemeinschaften in Deutschland haben widerstandsfähige Netzwerke der Solidarität geschaffen und bedeutende Beiträge zur Gesellschaft geleistet. 1984 – genau 100 Jahre nach der Berliner Konferenz – nahm die bekannte Dichterin Audre Lorde eine Gastprofessur an der Freien Universität Berlin an. Sie spielte eine zentrale Rolle in der Entwicklung einer Schwarzen Bewegung und prägte den Begriff „Afrodeutsch“, um Schwarzen Deutschen ein neues Identitätsgefühl zu geben. Ihr intersektionaler Ansatz zu Unterdrückung und ihre Advocacy für LGBTQIA+-Rechte erweiterten den deutschen akademischen und aktivistischen Diskurs über Rasse und Geschlecht. Eine weitere Schlüsselfigur war May Ayim, Mitbegründerin der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, einer Organisation, die sich für Schwarze, politische Interessenvertretung, Repräsentation und Bildung einsetzt. 1996 organisierte die Initiative Deutschlands ersten Black History Month.
Heute sind Schwarze Deutsche in allen Bereichen der Gesellschaft vertreten und die deutsche Kultur stark geprägt. Jedoch bleibt rassistische Diskriminierung ein präsentes Problem. Anders als in den USA oder Großbritannien erhebt Deutschland keine statistischen Daten zu ethnischer Zugehörigkeit und beruft sich dabei auf Datenschutzbedenken und auf „Farbenblindheit“, wenn es um ethnische Merkmale geht. Doch diese Abwesenheit von Datenanalyse ermöglicht es dem Staat, systemischen Rassismus zu ignorieren und zu produzieren. Studien belegen, dass kein öffentlicher oder privater Raum in Deutschland frei von rassistischen Vorurteilen ist. Der Black History Month bietet die Gelegenheit, hegemoniale historische Narrative zu hinterfragen und marginalisierte Stimmen zu stärken. Gerade in Deutschland bedeutet dies die Auseinandersetzung mit kolonialen Verbrechen und faschistischer Gewalt sowie die Konfrontation mit aktuellen rassistischen Ungerechtigkeiten. Leider liegt die Verantwortung für diese Bildungsarbeit weiterhin bei Basisorganisationen, Aktivist:innen und vor allem hauptsächlich bei Afrodeutschen selbst. Darüber hinaus wird die Unterdrückung, die Schwarze Menschen in Deutschland erfahren, weiterhin verschwiegen und heruntergespielt. Um Carter G. Woodsons Vision wirklich zu ehren, darf an die Schwarze Geschichte nicht nur erinnert werden – sie muss als Impuls für strukturellen Wandel und bedeutungsvolle Handlungen dienen. In Deutschland bedeutet dies aktive Solidarität mit Schwarzen Gemeinschaften, die Auseinandersetzung mit afrodeutschen Realitäten und ein unerschütterliches Engagement für die Beseitigung rassistischer Ungerechtigkeit – nicht nur in der Theorie, sondern vor allem in der Praxis.
Möchtest du über die Aktionen von DiEM25 informiert werden? Registriere dich hier