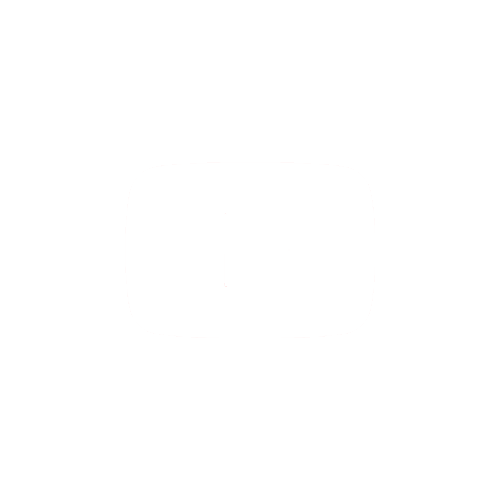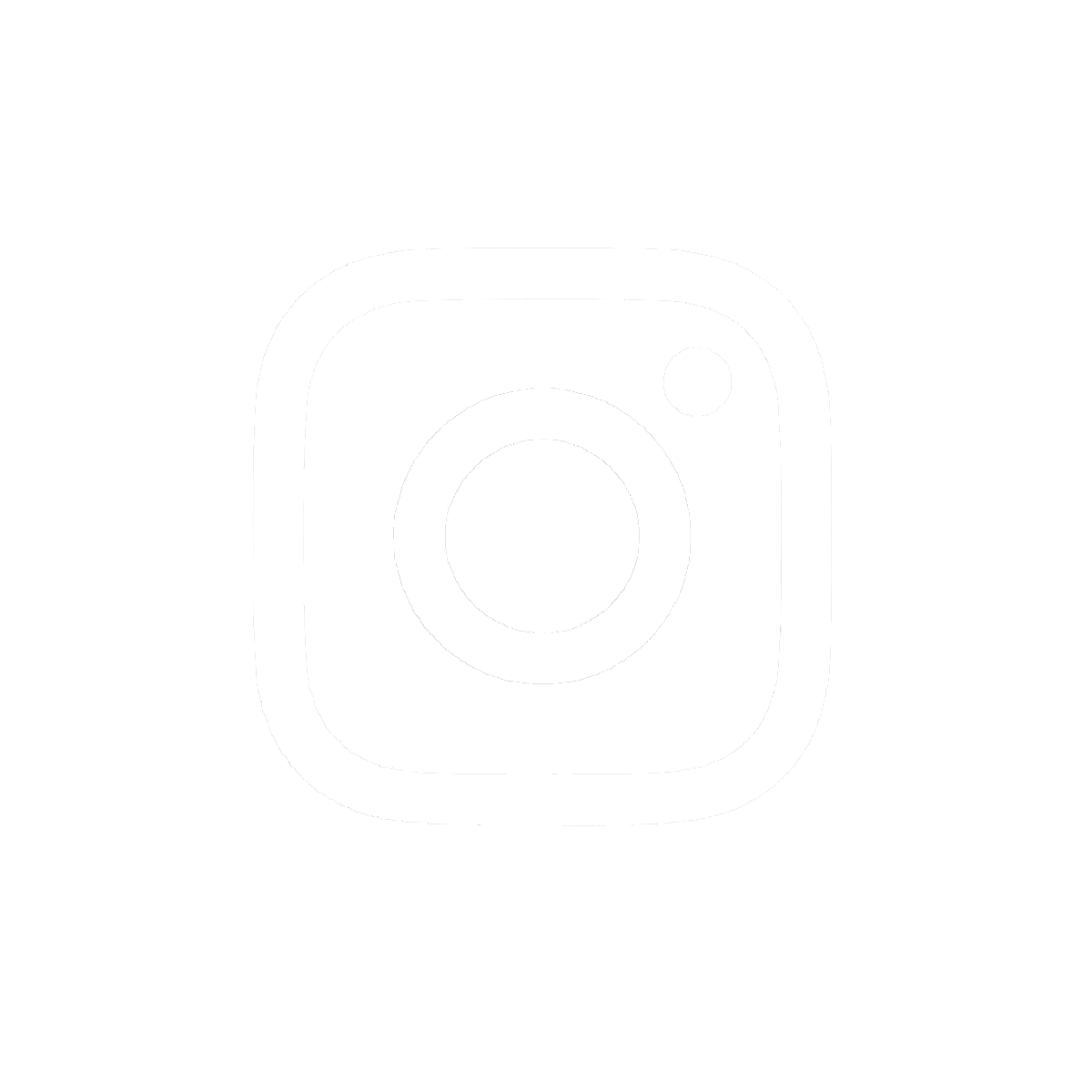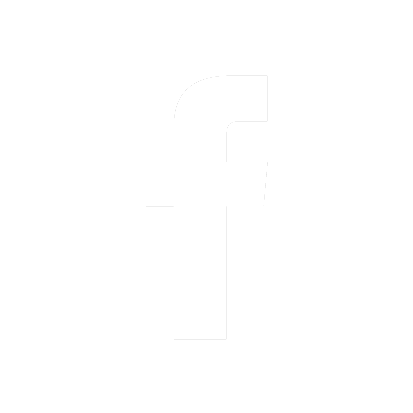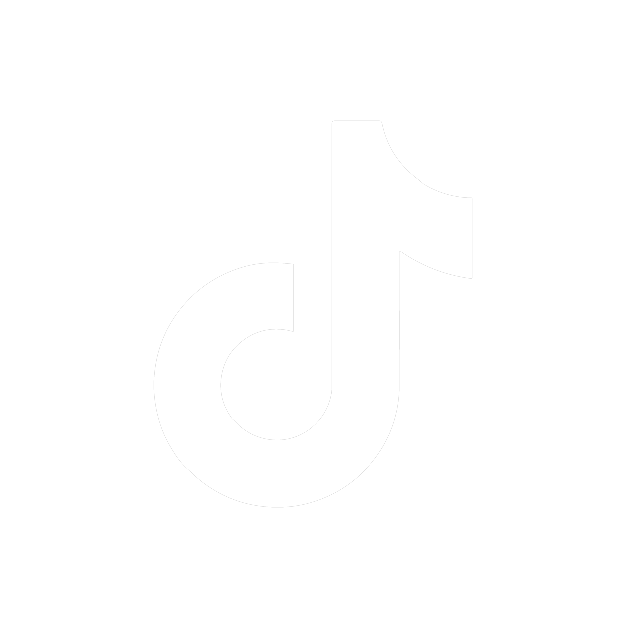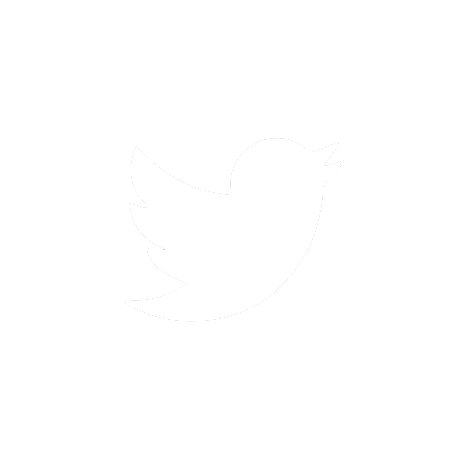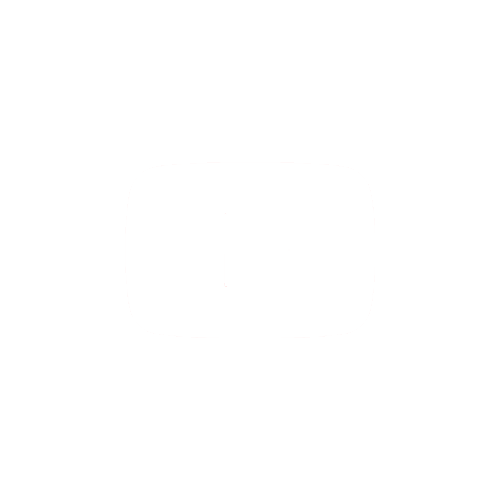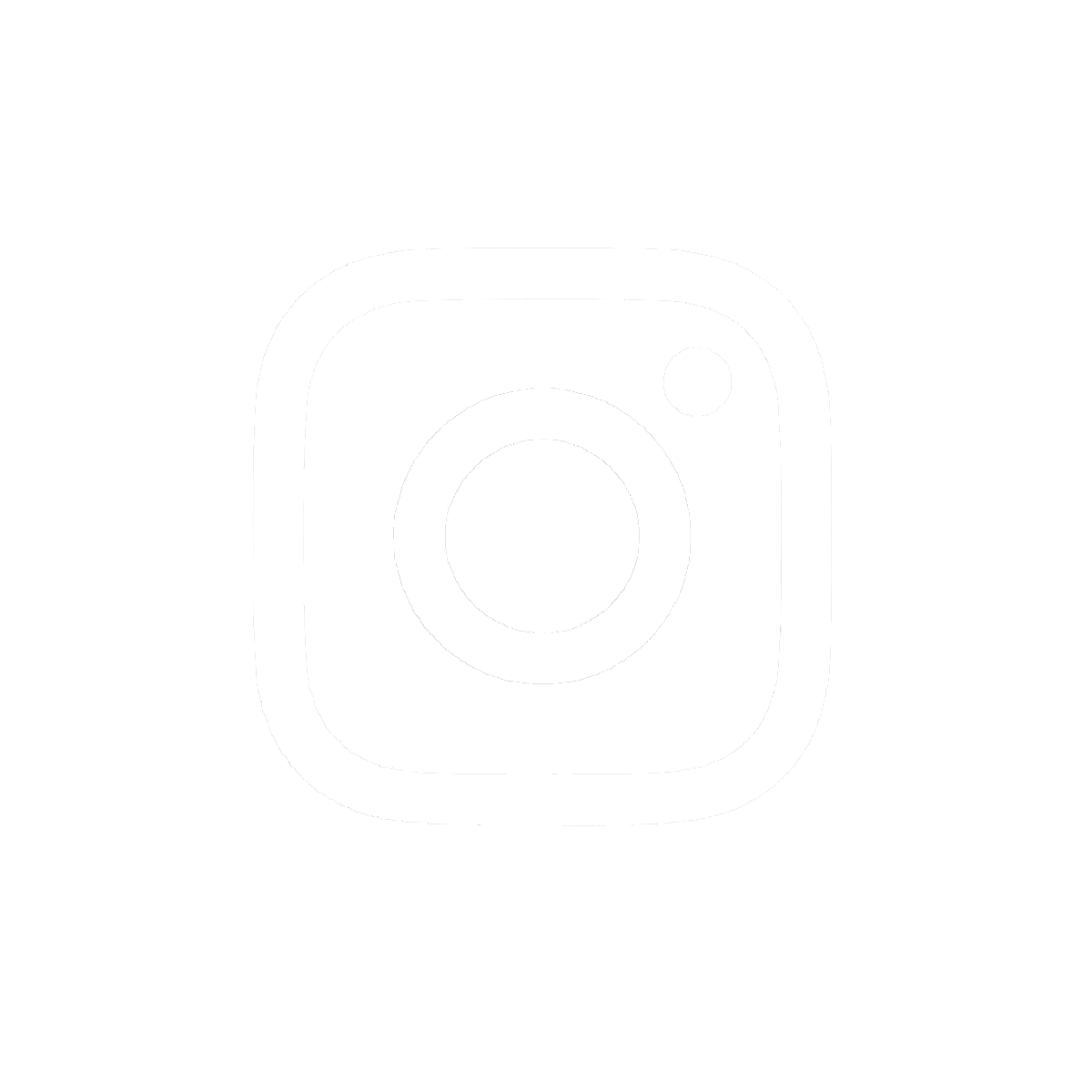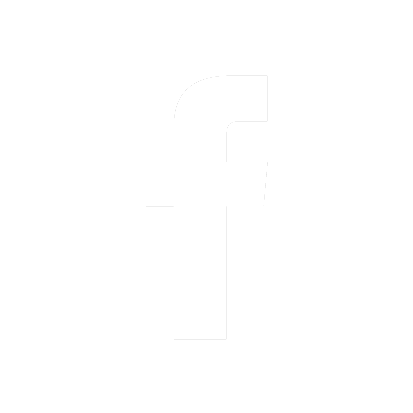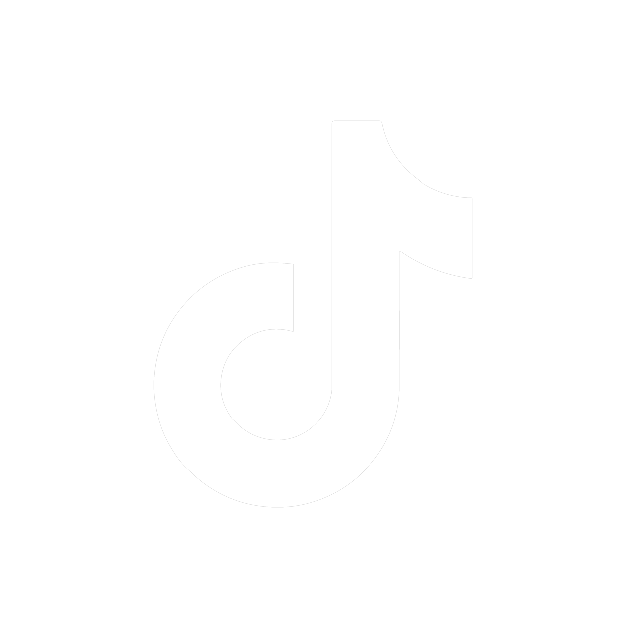Zwei junge politische Aktivistinnen blicken auf #MeToo. Ein Dialog von Elisa Stowe und Kasia Wojcik.
Prolog
Ich laufe am Straßenrand entlang, dem einzigen Weg durchs Dorf, zurück zu meinem Guest House im Süden Sri Lankas, als mir ein Mopedfahrer im Vorbeifahren auf den Hintern haut. Bis ich Arschloch schreien kann, ist der Mann längst weg.
Während ich mit einem Freund in einem Berliner Club ein angetrunkenes Gespräch führe, fasst mir ein unbekannter Mann an Brust und Hintern. Ich winde mich lächelnd und entferne mich aus seiner Reichweite.
„Die Freiheit ist die Freiheit des anderen.“
Rosa Luxemburg
Es ist ein prominentes Gesicht, das der Debatte um #MeToo seit dem Erscheinen des Textes in der Le Monde, einen Spiegel vorhält, in dessen Rückspiegelung sich die eigentlichen Wurzeln der Problematik im Dämmerlicht erkennen lassen. Catherine Deneuve, heute 74, immer noch eine sehr schöne Frau.
Rund einhundert Französinnen unterzeichneten Deneuves‘ Brief als Antwort auf die virale Social Media Kampagne #MeToo, die wiederum durch die Schauspielerin Alyssa Milano populär wurde. Ursprünglich war es die Bürger*innenrechtsaktivistin Tarana Burk, die bereits vor über zehn Jahren eine Bewegung mit dem Namen Me too ins Leben rief, um damit auf die tiefgehende Verbreitung sexuellen Missbrauchs und täglicher Übergriffe aufmerksam zu machen. Unter dem Hashtag #MeToo versammeln sich nun seit Oktober des letzten Jahres die Geschichten von Frauen, deren Verbindungen durch ähnliche Erfahrungen bestehen. Missbrauch, Gewalt, Übergriffe, unfreiwillige Flirts, nicht Nein-Sagen; immer die Frage dabei, wer die Norm setzt.
In ihrem Brief, der in einer der wichtigsten französischen Tageszeitungen erschien, werfen die Frauen um Deneuve der #MeToo- Debatte vor, zu weit gegangen zu sein. Sie schaffe ein „Klima der Denunziation“. Mit diesem Feminismus könnten sie sich nicht identifizieren, einem Feminismus, der „über die Verurteilung des Machtmissbrauches hinausgehend ein Gesicht von Männerhass und Sexualfeindlichkeit annimmt“. Sie sähen sich als die Verteidigerinnen sexueller Freiheit gegenüber einem Puritanismus, der letztlich reaktionären Kräften in die Finger spiele.
Viele dieser Unterzeichnerinnen tragen keine unbekannten Namen. Sie sind Schriftstellerinnen und Psychologinnen, Schauspielerinnen, im Durchschnitt nicht besonders jung. Vor ein paar Tagen entschuldigte sich Frau Deneuve dann bei den Opfern sexueller Gewalt. Freilich, sie bleibt bei ihrer Überzeugung.
„Ihr Anliegen, die sexuelle Freiheit gegen reaktionäre Bestrebungen zu verteidigen, die alles Intime unter dem Mantel des moralisch Korrekten pauschal und öffentlich anprangern, scheint legitim“, heißt es in der TAZ (11.02.2018). Dem können wir leicht zustimmen, wäre es doch schön, hätten wir diesen Grad der Freiheit längst erreicht. Dass dem aber nicht so ist, zeigt der andauernde Protest der Pol*innen gegen die Bestrebungen ihrer rechts-konservativen Regierung, Abtreibungsrechte immer weiter einzuschränken. Versinnbildlicht sich in der Präsidentschaft Trumps, die tief in Misogynie wurzelt, zeigt sich im Kampf der Kurd*innen gegen die faschistische Herrschaft des so genannten islamischen Staats, sowie im weltweiten Erstarken nationalistischer, antidemokratischer Kräfte. Dass dem einfach nicht so ist, zeigt auch #MeToo; dass genau darüber nicht gesprochen wird, der Brief aus der Le Monde.
Weltweit flattern die Antworten auf die Antwort ein. Es entsteht eine simplifizierende, Pro/Kontra-Debatte, ein intellektueller Diskurs, der einen Freiheitsbegriff und einen Begriff der Emanzipation voraussetzt, der auf bereits bestehenden Privilegien fußt, welche die Französinnen offenbar besitzen. Wir sind doch alle gleich, ‚chillt‘ mal.
Wie bei #MeToo um Sexismus, so geht es bei #BlackLivesMatter um Rassismus, bei #GrenfellTower um die fatalen strukturellen Versäumnisse einer Politik, die seit bald vierzig Jahren Alternativlosigkeit suggeriert. Die Kohäsion zwischen den Gesichtern dieser Hashtag-Kampagnen sind sozial erschaffene Umstände.
Wer schon einmal ungewollt schwanger war, vielleicht mit Anfang zwanzig, wird anders über Abtreibung denken. Karrierismus, Individualismus, Stigmatisierung, das Recht auf Leben, frühe mütterliche Gefühle, Druck.
Wer weiß, dass Leistung nicht alles ist, wählt nicht die FDP.
Wer weiß, was die Kombination von Sexualität, Macht und Gewalt bedeutet, spricht nicht von Lust.
Statt aber mit Solidarität zu antworten, passiert etwas Urtypisches für derlei Debatten. Eine urtümliche Konkurrenz, eine schillernde Facette eines globalen, deregulierten, neoliberalen Kapitalismus, unterwandert die Debatte. Die Philosophin und Feministin Nancy Fraser kritisiert die gefährliche Liason zwischen Feminismus und Neoliberalismus. Für sie gelte es, diese aufzubrechen. Der sogenannte Second Wave Feminism, nach der Ausweitung von individueller Autonomie strebend, fiel in seiner Ambivalenz der Herausbildung eines neuen Kapitalismus in die Hände. „Die identitätspolitische Wende des Feminismus“, schreibt Fraser, „passte nur zu gut zum Aufstieg eines Neoliberalismus, dem es vor allem darum ging, den Gedanken der sozialen Gleichberechtigung aus dem öffentlichen Gedächtnis zu tilgen.“ Weiter schreibt sie, wir hätten „die Kritik des kulturellen Sexismus in dem Augenblick verabsolutiert, in dem die Verhältnisse eine energische Besinnung auf die Kritik der Politischen Ökonomie erfordert hätten.“ Die einen auf die anderen, Feminismus versus Feminismus, Emanzipation contre émancipation, Frau gegen Frau, heute. Wir sind nicht alle gleich.
Während im Brief der Französinnen von einem Witch-Hunt die Rede ist, denken wir an die Journalist*innen in den türkischen Gefängnissen.
Der Vergleich hinkt und gleicht einem Oxymoron. Die Aktivistin, Philosophin und Feministin Silvia Federici, die der italienischen Autonomia zugeordnet werden kann, analysiert in „Caliban and the Witch“ den wahren Witch-Hunt und fragt, warum der Aufstieg des Kapitalismus einen genozidalen Angriff auf Frauen forderte.
Patriarchale Herrschaft, tief verwoben mit unserer Wirtschaftsweise, nationalstaatlicher Organisation, sowie mit unserer Art, die Welt zu sehen, mit den Kategorien, die wir dazu kennen, trägt ein hässliches Gesicht und artikuliert sich im Sexismus.
Harvey Weinstein ist dabei zum Parade-Hassobjekt geworden, besser hätte es Hollywood nicht erzählen können. In all dem Stimmengewirr sprechen die Reichen und Schönen, die Französinnen und die Schauspielerinnen in LA, in der Le Monde Dimplomatique und auf den anderen analogen und virtuellen Zeitungsplattformen der westlichen Welt. Die anderen twittern ein #MeToo darüber oder schweigen, oder beides. Die eigentliche, strukturelle Problematik fällt dabei unter den Tisch, nachdem sie mit dem Etikett Hysterie versehen wurde.
Die Versuche, andere Frauen nicht als Konkurrentinnen wahrzunehmen, ob in der Arbeitswelt, der Liebe, in Freundschaften, stoßen oftmals auf Abwehr.
Besonders deutlich wird das auf politischen Veranstaltungen, die oftmals von männlichem Redeverhalten dominiert werden; wo jede Frau für sich zu kämpfen scheint, um als vollwertige politische Gesprächspartnerin anerkannt zu werden. Wo man so tun muss, als wäre man eine der Dudes, um anerkannt zu werden. Check.
Um endlich aus dieser Spirale auszutreten, wäre es einen Versuch wert, die Brille des Konkurrenzdenkens abzusetzen. Kein leichtes Unterfangen, wenn man bedenkt, wie tief verinnerlicht doch so ein Denken ist. Scheitert dieser Selbstversuch, empfiehlt sich ein Blick in den Rückspiegel und dazu einer nach vorne. Oder um es noch einmal mit Federici zu sagen:
„[I]t is through the day-to-day activities by means of which we produce our existence, that we can develop our capacity to cooperate and not only resist our dehumanization but learn to reconstruct the world as a space of nurturing, creativity, and care“ (Revolution at Point Zero).
Epilog
Ich laufe zurück zu meinem Guest House. Ein Lächeln im Vorbeifahren.
In einem Berliner Club spreche ich mit einem Freund über Lust und Begehren. Ich fühle mich nicht bedrängt. Es gibt einen Unterschied.
Elisa (23), studiert Anthropologie und Literaturwissenschaft, Kasia (27), studiert Theaterwissenschaften. Die beiden engagieren sich bei DiEM25 im Bundeskollektiv für die Vernetzung von Bewegungen und Organisationen. DiEM25 ist eine pan-europäische Bewegung zur Demokratisierung der EU.
Der Text entstand aus einem Dialog zwischen den beiden jungen Frauen. Auch wenn Elisa die Hauptverfasserin ist, finden sie, dass es weniger um Urheberschaft als mehr um Kollaboration und Gedankenaustausch geht. Sie träumen davon, einfach Kunst zu machen.
Möchtest du über die Aktionen von DiEM25 informiert werden? Registriere dich hier